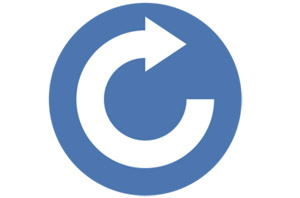Was ist eigentlich eine erfolgreiche Gemeinschaft?
Ich glaube, von der Idee, durch eine Gemeinschaftsgründung von jetzt auf gleich eine neue Gesellschaft zu entwicklen, sollte man tunlichst die Finger lassen. Die „Pioniere“ in Newtopia schreiben immer noch „Wir sind hier 15 Pioniere und versuchen für ein Jahr eine neue Gesellschaft aufzubauen“* – so, so. Ich denke, wenn eine Gemeinschaft nach der aufregenden Gründungsphase bestehen bleibt und tatsächlich ein bisschen von der Lebensqualität bietet, die einst anvisiert war, ist das schon sehr respektabel. Denn wie schon gesagt – eine erprobte, belastbare Gemeinschaftskultur gibt es ja (noch) gar nicht (mehr).
Durch eine Gemeinschaftsgründung reich zu werden, ist dann wohl endgültig Fantasterei. Mir ist kein Beispiel bekannt. Angeblich haben sich Gruppen aus dem Umfeld von Otto Mühl vor langer langer Zeit mit Versicherungsgeschäften selbständig gemacht und damit ordentlich Geld verdient. Aber die großen Firmen und die reichen Reichen unserer Zeit sind, befürchte ich, nicht aus idealistischen Gemeinschaften hervorgegangen. Ich freue mich über Richtigstellungen. Die Vorstellung ist natürlich faszinierend: Zusammen leben, zusammen Arbeiten, zusammen Erfolg haben. Ich erinnere mich an das schöne Buch Microserfs (dt. Microsklaven) von Douglas Coupland, da wohnen ein paar Nerds als (Wohn-)Gemeinschaft zusammen und basteln über Monate an einem Computerspiel. Ich erinnere mich nicht mehr, ob das am Ende wirklich ein Renner wird, aber die Möglichkeit besteht.
Eine doch erfolgreiche Gemeinschaft habe ich 2010 in den USA kennengelernt. Auch dort ist niemand reich und der Lebensstandard liegt doch deutlich unter dem, den wir in Sieben Linden genießen – aber in Twin Oaks ist wirtschaftlich enorm was auf die Beine gestellt worden, und faszinierend ist dort, dass tatsächlich jede*r mitgenommen wird. Es gibt eine gemeinsame Ökonomie und eine sehr große Toleranz. Und dabei doch eine hohe Verbindlichkeit und sogar Disziplin, was gewisse bürokratische Notwendigkeiten angeht.
Unten ein Text, der in der ersten Auflage meines Buches Öko Dorf Welt im Anhang abgedruckt war.
*in einer Mail ans Ökodorf Sieben Linden, über die ich vielleicht ein andermal schreiben werde
Leben nach Plan
Das Labor Credit System der Kommune Twin Oaks
(Verfasst für eine deutsche Wirtschaftszeitschrift)
Haben Sie Zeit? Leben Sie im Stress? Verdienen Sie genug, um Ihre Freizeit genießen zu können, oder verbrauchen Sie so viel Zeit mit Ihrer Arbeit, dass Ihnen das verdiente Geld gar nichts nützt?
Diese Fragen sind nicht automatisch vom Tisch, wenn Sie mit Gleichgesinnten in enger Gemeinschaft leben und alles teilen. Im Gegenteil: Viele, die das hoffen, wagen den Schritt ins alternative Leben – in ein Kollektiv, ein Ökodorf, ein Mehrgenerationenprojekt – und verlieren sich dann erst recht zwischen Arbeit und materiellen Zwängen. Es gibt immer was zu tun, erst recht, wenn man selbstbestimmt lebt.
Die Kommune Twin Oaks in Virginia, USA, hat sich dieser unbarmherzigen Realität gestellt – es gibt nur so viel Zeit, aber wir brauchen so viel Geld – und eine pragmatische Lösung gefunden: Die „Quota“. Ein Arbeitspensum von 42 Stunden pro Woche, das alle Bewohner von Twin Oaks zu leisten haben. Die aktuelle Jahresberechnung ergibt, dass dann genug gearbeitet wird, um die materiellen Bedürfnisse der Gemeinschaft – gedeckt durch Selbstversorgung und durch finanzielle Einkünfte – zu befriedigen.
„Twin Oaks“ ist natürlich noch viel mehr als die Quota. Es ist die am längsten bestehende nicht spirituell festgelegte große Lebensgemeinschaft in den Vereinigten Staaten. Sie besteht aus etwa 100 Erwachsenen und 15 Kindern und wurde 1967 gegründet. Die Pioniere ließen sich vom Buch „Walden Two“ des Psychologen B.F. Skinner inspirieren, einem wichtigen Vertreter des Behaviorismus, der dort in Romanform seine Utopie eines aggressionslosen Gemeinwesens beschrieb. Ihm ging es um positive Verstärkung: Bedingungen zu schaffen, in der Menschen sich freiwillig für die Verhaltensweise entscheiden, die dem Gemeinwohl dient. Und es ging ihm um Gerechtigkeit. In seinem literarischen Utopia hatten alle den gleichen Zugriff auf die Ressourcen der Gemeinschaft, und alle leisteten – gemessen und erfasst in komplizierten Berechnungen – gleich viel.
Die real existierende Kommune hat sich nur kurz mit Skinners Ideen beschäftigt – zu dringend waren in den Anfangsjahren die Probleme der Bewohnerfluktuation und des Geldmangels. Nachdem sich eine gewisse Stabilität eingestellt hatte und die Gruppe stetig wuchs, war die Bewohnerschaft schon zu divers, um Einigkeit über die abstrakten behavioristischen Ideen Skinners herzustellen. Ein paar Ideen haben aber überlebt und funktionieren heute prächtig – zum Beispiel die Sache mit der Quota.
Ein_e Twin Oaker_in führt ein Blatt Papier mit den genauen Zeiten, die er oder sie arbeitenderweise verbringt. Zu den 42 Stunden pro Woche, die zu erfüllen sind, wird alles gezählt, was nicht ganz privat ist: „Ich kann dabei kein Buch lesen – also ist es Arbeit“. Und Arbeit wird auf die Quota angerechnet. Einen Videofilm für die anderen Gemeinschaftsmitglieder vorführen, mal eben den Kühlschrank auswischen, zwei Stunden spielen mit einem Kind – das zählt als Arbeit, genauso, wie in der Tofufabrik an der Maschine zu stehen oder im Büro die Buchhaltung zu machen.
Die meisten Bewohner machen verschiedene Dinge abwechselnd. Und wer mehr als 42 Stunden pro Woche auf diese Weise arbeitet, sammelt Überstunden – muss also in späteren Wochen weniger arbeiten. Die Zahl 42 ist variabel – nächstes Jahr muss vielleicht weniger oder mehr gearbeitet werden, je nachdem, wie effektiv die gemeinschaftlichen Betriebe und wie hoch die Ansprüche an den Lebensstandard sind.
Tatsächlich wirken die Twin Oaker_innen zufrieden und jedenfalls nicht gestresst. Klagen über zu wenig Zeit, über Stress und Überforderung sind nicht zu hören, im Gegensatz zur deutschen Normkultur, wo sich Menschen spezialisieren, auf bestimmte Arbeiten festlegen und ein Wechsel des Berufs eine ganz große Sache ist. Wo zu spüren ist, dass Fachkräften mehr Achtung entgegengebracht wird als eher unqualifizierten Arbeiter_innenn und sich das vor allem finanziell auswirkt. Der Arzt verdient ein Vielfaches von der Sozialarbeiterin, auch wenn die sich vielleicht auch noch ehrenamtlich engagiert. Das würde in Twin Oaks nicht passieren – dort würde auch das Ehrenamt auf die Quota angerechnet und sowieso gehört alles allen. Eine gemeinsame Ökonomie, in der lediglich etwas Taschengeld für den Luxus ausgezahlt wird, den das Gemeinschaftsleben nicht vorhält: Zwei Euro pro Tag und Nase, für Schokolade oder Bier zum Beispiel. Eventuell vorhandenes Privatvermögen wird der Kommune vor dem Beitritt als Darlehen zur Verfügung gestellt und steht für Privatkonsum nicht mehr zur Verfügung.
Ein großer Teil der Arbeitskraft muss in die zwei Firmen von Twin Oaks fließen, die Hängematten-Manufaktur und die Tofuküche. Die Kommune braucht „Devisen“, obwohl sie einen großen Garten bewirtschaftet, Fleisch und Milch produziert und vieles selbst gebaut und repariert werden kann. Die Bedürfnisse der Geld verdienenden Betriebe haben Priorität, wenn der Haushalt fürs nächste Jahr festgelegt wird, und zwar nicht nur der Finanz-, sondern auch der Zeithaushalt. Es wird ermittelt, viele Stunden am Tofukessel und wie viele am Webegestell verbracht werden müssen, um die voraussichtliche Nachfrage (und den finanziellen Bedarf der Gemeinschaft) zu erfüllen.
Natürlich bleiben genügend Stunden übrig, die auf die anderen Arbeitsbereiche „verteilt“ werden können. So bewilligten die „Planer“ der Küche für 2010 4958 Stunden zum Kochen und 4782 zum Putzen. Der Bedarf wurde 2009 vom „Manager“ der Küche angemeldet und mit wenigen Abstrichen bewilligt. Ein Bereich wie der Garten muss dagegen vielleicht mit weniger als den angemeldeten Stunden auskommen, denn Gemüse kann man zukaufen – das ist weniger romantisch, aber billiger. Es herrscht eine recht unsentimentale Planwirtschaft. Die Gemeinschaft als Ganzes muss funktionieren. Zur Zeit tut sie das, wenn jeder Bewohner und jede Bewohnerin 42 Stunden pro Woche arbeitet.
Das Aufstellen eines Haushaltsplans ist für jeden Betriebswirt ein alter Hut. Im Privaten aber zu planen, wie viele Stunden Fahrräder repariert, Blumen gepflanzt oder auch Kinder gehütet werden, hat unerhörte Folgen fürs eigene Leben. Es ist ja nicht damit getan, 42 Stunden irgendwas zu tun. Vielmehr müssen die Stunden in den Bereichen abgeleistet werden, in denen die Stunden bewilligt wurden. Zum Beispiel beim Tofu.
Sabrina ist 20 und seit zwei Jahren in Twin Oaks. Sie ist dafür verantwortlich, dass die Tofuproduktion der nächsten Woche läuft. Am Montagabend nimmt sie sich die „Labor Sheets“ aus dem Holzkasten – ein Blatt von jede_r Bewohner_in, in dem Vorlieben für nächste Woche sowie die Zeiten vermerkt sind, an denen er oder sie nicht zum Arbeiten zur Verfügung steht. Es entsteht ein Stundenplan. Wer keine festen Bereiche oder Zeiten hat, wird mit bis zu 42 Stunden irgendwo eingeplant und erfährt am Donnerstagabend, wie ihre oder seine nächste Woche verlaufen wird. Manche schreiben auf ihr Blatt „Bitte für 10 Stunden Tofu einteilen“ oder „bin die ganze Woche mit Buchhaltung beschäftigt“. Wesentlich ist, dass jedes Mitglied sowieso 42 Stunden arbeiten muss. Das wird von allen respektiert. Falls ein Mitglied auf Dauer weniger als 42 Stunden pro Woche arbeitet, tritt ein sozialer Mechanismus mit Meetings und Unterstützer_innen in Gang, um dem Mitglied zu helfen, aus dem „Labor Hole“ zu kommen und ein ausgeglichenes Zeitbudget wiederzuerlangen. Wer krank ist, kann sich bis zu sechs „Sick Hours“ pro Tag aufschreiben. Diese Stunden gelten auf dem Stundenblatt wie Arbeitszeit. Freistunden sammeln sich an, wenn die ausgefüllten Labor Sheets pünktlich eingereicht werden. Dafür gibt es als Belohnung jede Woche ein bisschen Zeit geschenkt, die sich zum Urlaub addiert.

Sabrina taktet die Arbeit in der Tofuküche ein, bevor die restlichen Arbeiten verteilt werden – denn nirgendwo ist es wichtiger, dass alle zur richtigen Zeit an ihrem Platz sind. Nachdem sie die jeweiligen Expert_innen für die Arbeit am Kessel, an der Formpress- und an der Verpackungsmaschine eingetragen hat, kann sie die dazugehörigen Helferschichten auch mit weniger qualifiziertem Personal oder mit Gästen bestücken, die mitarbeiten, sobald sie länger als eine Woche zu Besuch sind.
Johanna aus Deutschland, die am Ende einer USA-Reise an der dreiwöchigen Besucherzeit in Twin Oaks teilnimmt, ist von ihren durchgeplanten Tagen nach anfänglicher Faszination nicht mehr so begeistert. Neben mehreren Informationsveranstaltungen für Neulinge, die ihr auch auf die Quota angerechnet werden, darf/muss sie im Garten, in der Küche, beim Pflanzensamenpulen, beim Einkochen und beim Putzen helfen. „Ich mag nicht, dass jemand anderes meinen Tagesplan strukturiert. Ich habe das Gefühl, dadurch unspontan und abhängig zu werden – ich fühle mich fremdbestimmt.“ Der bunt durcheinander gewürfelte Stundenplan ist typisch für die Besucherzeit in Twin Oaks – schließlich sollen die Besucher_innen als potenzielle neue Mitglieder möglichst viele verschiedene Eindrücke in das Gemeinschaftsleben erhalten. Immerhin lernt sie das Hängemattenweben und kann sich die Zeit dafür selbst in den Wochenplan schreiben: 32 Stunden wurden ihr mit Terminen zugeteilt, 10 Stunden fürs Weben leistet sie, wann es ihr passt. Die Werkstatt ist immer offen.
Renée, eine andere Besucherin, kann ein Lied davon singen, dass das Gemeinschaftsleben für die Besucher_innen nicht beschönigt wird. Abgesehen davon, dass sie für ihren Geschmack zu viele Putzschichten absolvieren muss, sieht sie aber ein Problem für sich. Sie plant, im nächsten Jahr eine Lehre als Hebamme zu beginnen, und stößt damit an eine der Grenzen der Twin-Oaks-Welt. „Die Gemeinschaft müsste unterstützen, dass ich eine Vollzeitausbildung außerhalb absolviere, statt Quota zu leisten.“ Außerdem müssten die Hebammenschule und die Fahrten dorthin bezahlt werden. Ein entsprechender Antrag würde diskutiert werden, aber tatsächlich besteht die Gefahr, dass Mitglieder nach erfolgter, durch Twin Oaks finanzierter Ausbildung wieder ausziehen. Bei den eigenen Kindern nimmt die Gemeinschaft das in Kauf und finanziert gegebenenfalls auch das College, aber die Ausbildung von (neuen) Mitgliedern birgt ein reales Risiko für die gemeinsame Ökonomie. Das ist die Kehrseite der Freiheit, jederzeit wieder gehen zu können. „Ich würde bestimmt interessante Arbeiten hier finden“, meint Renée, „aber nichts, was mich so erfüllt, wie ich mir das vom Hebammenberuf erhoffe.“
In „Walden Two“, der fiktiven Gemeinschaft aus dem Buch, leben mehr als 1000 Menschen und selbstverständlich finanziert das Gemeinwesen dort auch spezialisierte Ausbildungen zum Beispiel für Mediziner. Anders als in der US-amerikanischen Realität haben die Mitglieder auch keinerlei Ambitionen, das fiktive „Walden Two“ jemals wieder zu verlassen. In Twin Oaks dagegen herrscht ein stetiger Umlauf: 25% Fluktuation pro Jahr sind gewöhnlich und gelten auch nicht als Problem. Es sind vor allem neue, junge Mitglieder, die sich die Kommune eine Zeit lang ansehen und dann wieder gehen. Zwar kostet deren Integration viel Aufwand, aber es bleibt interessant in der Gruppe. Außerdem tragen die Gehenden die Idee der Alternative hinein in den Mainstream. Das Kommen und Gehen wird nicht als Problem betrachtet.
Das irrationale Bedürfnis nach Individualismus ist im Buch kein Thema, in der Realität aber sehr wohl – siehe Renée. In Twin Oaks bestimmt das Labor Sheet den Tag, und ein gemeinsamer Abend in der Badewanne sollte vorsichtshalber von beiden Badenden im Stundenplan der nächsten Woche ausgeblockt werden – sonst kommt vielleicht die ungeliebte letzte Küchenputzschicht nach dem Abendessen dazwischen, zu der jede_r mal eingeteilt wird. Vielleicht noch schwieriger zu schlucken für Kinder unserer Zeit: Es gibt keine Karrieren im herkömmlichen Sinn. Es gibt keine materielle Gratifikation für gute, verantwortungsvolle Arbeit. Wenn eine Frau aus dem Tofumarketing es schafft, einen Deal mit einer großen Supermarktkette an Land zu ziehen und die Kommune damit auf Jahre mit bezahlter Arbeit zu versorgen, bekommt sie dafür noch nicht mal einen neuen Schreibtischstuhl. Geschweige denn einen Umzug in die Führungsetage. Weil es die nicht gibt. Die Frau aus dem Beispiel würde diese Arbeit tun, weil sie ihr Spaß macht und weil sie die Gesamtgemeinschaft weiterbringt. Die Gratifikation liefert das Gemeinschaftsleben: Gute soziale Beziehungen, Zeit für Alte und Kinder, kein Defizit an Liebe und Zärtlichkeit. Es klingt nett, ist aber eine Herausforderung, die nicht unterschätzt werden sollte: Sich motivieren zu lassen nur von dem Gefühl, ein sinnvolles Leben zu führen.
Es gibt andere Gemeinschaften mit gemeinsamer Ökonomie, in denen es keine Stundenpläne gibt – weil z.B. jedes Mitglied viel fester in bestimmten Arbeitsbereichen eingebunden ist. Viele würden auch nicht anders arbeiten wollen. Schließlich kann es sehr befriedigend sein, sich in Arbeit zu vertiefen, ein_e „Meister_in seines/ihres Fachs“ zu werden. Die Menschen von Twin Oaks aber haben sich nicht nur für die Stundenpläne, sondern auch für die Abwechslung entschieden. Zwar haben sich einige Kommunarden spezialisiert, die Arbeitsschichten der meisten anderen dauern aber nur zwei bis drei Stunden, dann ist etwas anderes dran. „Es wurde wohl mal festgestellt, dass wir damit effektiver sind“, erklärt Sabrina, die noch gar nicht geboren war, als in Twin Oaks schon Labor Sheets kursierten. Immerhin bleibt so niemand auf langen Schichten mit Drecksarbeit sitzen.
Die Labor Sheets sind auch zweckmäßig, weil in Twin Oaks viel in Teams gearbeitet wird. Sowohl gemeinsame Arbeitseinsätze als auch Besprechungen können zentral terminiert werden. Es ist leicht, zwischen Arbeitsbereichen hin- und herzuspringen und dadurch mal was Neues auszuprobieren, und sowohl Gäste als auch Kinder und Jugendliche können gut integriert werden. Dafür ist das System sowieso großartig: Schon kleine Kinder verstehen, was die Erwachsenen machen. Sie können unbefangen erforschen, was die verschiedenen Arbeiten bedeuten, und bekommen irgendwann ihr eigenes Labor Sheet – mit minimaler Quota natürlich, deren Erfüllung auch nicht sehr ernst genommen wird. Außer von den Kindern selbst. Sie sind mächtig stolz darauf, die ersten Stunden schreiben zu dürfen, und während für kleine Kinder auch Beobachtungsstunden zählen (Erwachsenen beim Arbeiten zusehen), putzt der 14-jährige Ronan schon in der Küche mit. Er braucht ewig, aber niemand hält ihn zur Eile an. Sein Vater Keenan erzählt, dass die ersten selbst vollbrachten Quotastunden eine magische Wirkung auf seine Kinder hatten. „Nach der Arbeit kamen sie auf einmal mit zum gemeinsamen Mittagessen, was sie sonst immer zu vermeiden suchten. Und wenn sie dann jemand darauf ansprach, was sie heute gemacht hätten, antworteten sie lässig, dass sie mit mir gebaut hätten.“
Keenan ist hauptberuflich Vater zweier Teenager, und damit, in Twin-Oaks-Sprech, gleichzeitig Manager dieser zwei „Arbeitsbereiche“. Pro Kind hat er rund 1000 Stunden pro Jahr zur Verfügung, die er entweder selbst verbrauchen oder weiterverteilen darf, vor allem an die „Primaries“. Das sind die festen Bezugspersonen, die jedes Kind haben soll, und die regelmäßig Zeit mit den Kindern verbringen, in der Regel je einen halben Tag pro Woche. Diese Zeit vergüten die Eltern den Primaries üblicherweise mit einem halben Stundenwert pro Stunde (also 2 Quotastunden für 4 Zeitstunden), weil während der Kinderbetreuung auch noch anderes gemacht werden kann. Und wohl auch, weil sich Twin Oaks sonst kaum Kinder leisten könnte. Die Stunden für die Kinderbetreuung würden schließlich auch anderswo gebraucht.
Keenan, der feingliedrige studierte Betriebswirt, arbeitet sonst an den Straßen der Gemeinschaft und im Bauteam – zuletzt vor allem an seinem Lieblingsprojekt, einem Hospiz für die Kommune. Er ist ein tolles Beispiel für die Egalität, die Gleichheit, die in Twin Oaks als wertvollstes Gut gilt. Durch die gleiche Arbeitszeit und das gleiche Taschengeld für alle Kommunarden ist es einfach für ihn, sich ausschließlich mit Handarbeit zu beschäftigen und doch nie das Gefühl zu haben, gegenüber Kopfarbeiter_innen benachteiligt zu sein. Mit seinem Uniabschluss würde er anderswo „mehr gelten“ als ein_e einfache_r Arbeiter_in – und wäre, im Umkehrschluss, vielleicht weniger angesehen, wenn er sich aufs Schaufeln und Schubkarrenschieben beschränkt. Hier nicht. Wie etliche andere ältere Gemeinschaftsmitglieder muss Keenan übrigens keine 42 Stunden pro Woche mehr arbeiten. Ab dem Alter von 50 Jahren bekommen die Kommunarden mit jedem weiteren Jahr ein Stundenguthaben pro Woche geschenkt. Genauso, wie Kinder in das System hineinwachsen, gleiten die Älteren aus ihm heraus. Eine 78-jährige arbeitet immer noch mit, wenn sie gesund ist – aber nur noch 13 Stunden pro Woche. Es ist ein ausgeklügeltes System, das seit 44 Jahren reift. Taugt es auch für Leute, die unbedingt Dinge tun wollen, die nicht unmittelbar dem Gemeinwohl dienen? What about Selbstverwirklichung?
Purl, der Künstler, fühlt sich nicht eingeschränkt, obwohl die Zeit, die er mit Kunst verbringt, nicht per se als Arbeitszeit gilt. Er arbeitet regulär seine Quota in der Fahrradwerkstatt und im Garten ab, fährt Tofu aus und kümmert sich um seine Tochter Anya. Wenn er auf einer Ausstellung etwas verkauft, schreibt er sich eine Stunde pro $10 auf, die er für die Gemeinschaftskasse verdient hat – natürlich kassiert er den Erlös nicht selbst. Dadurch wächst ihm ein Kunst-Zeit-Budget heran, das er für die nächsten Projekte nutzt. Außerdem gibt es die Personal Service Credits. Das sind angesparte Arbeitsstunden, die anderen Gemeinschaftsmitgliedern übertragen werden können – eine Art internes Zahlungsmittel. Wer möchte, kann Purl Zeit schenken, die er oder sie zusätzlich zur Wochenquota erarbeitet hat. Entweder projektbezogen für ein bestimmtes Bild oder Objekt, das sie oder er damit von Purl erwirbt, oder einfach so, um ihm zu ermöglichen, frei zu schaffen. Und wenn die Kunst sich nicht verkaufen oder niemandem so nützlich erscheinen würde, dass Purl dafür Credits bekäme? „Dann würde ich weniger schmökern oder Fahrradfahren“, überlegt er. „Wahrscheinlich würde ich mich sogar besser strukturieren, um Zeit für die Kunst zu finden. Ich würde nicht weniger Kunst, aber vielleicht andere Kunst machen. Wenn ich ganz unabhängig davon wäre, ob mir die Zeit angerechnet wird, würden vielleicht sogar persönlichere, politischere Werke entstehen, vielleicht sogar relevantere.“
Während er das sagt, wundert er sich über diese möglichen Folgen – warum kann das nicht schon jetzt so sein? Hört sich ja fast so an, als könne man vom Quota-erfüllen genauso abhängig werden wie vom Geldverdienen. Kat Kinkade, die Twin-Oaks-Mitgründerin, die fast durchgehend bis zu ihrem Tod in Twin Oaks gelebt und zwei erfrischend selbstkritische Bücher darüber geschrieben hat, weist in „Is it Utopia Yet (1994)“ auf das Problem dieser „Quotastunden-Mentalität“ hin: „Wer in diese Falle tappt, hat nicht so viel von unserem System wie die Leute, die sich einfach auf die Arbeit einlassen und ihr Stundenblatt nur als Werkzeug benutzen.“
Genau das habe ich vor, wenn ich jetzt auch in Deutschland meine Stunden aufschreibe. Das bedeutet erst mal Extra-Aufwand. Aufwand von der bürokratischen Sorte. Mein Labor-Sheet ist auch gleich viel komplizierter geworden als das in Twin Oaks. 36 verschiedene Arbeitspositionen sind mir für mein deutsches Arbeitsleben als Selbständiger insgesamt eingefallen, bis zu 14 verschiedene Positionen muss ich an einem einzigen Tag vermerken. Oft Kleckerkram von 0,2 Stunden, aber doch einzelne „Kostenstellen“. 8 von den 14 genannten Positionen finden ganz oder teilweise an meinem Computer statt, das heißt, ich muss mich ständig selbst unterbrechen und mir klar machen, dass ich jetzt nicht mehr Rechnungen für meine pflegebedürftige Mutter überweise, sondern schon dabei bin, DVD-Bestellungen für meine Filme zu bearbeiten. Das war in Twin Oaks anders, aber dort war ich auch nur Gast und hatte keine Leitungsposition. In Deutschland bin ich für fast alle meine Gewerke selbst verantwortlich.
Warum führe ich jetzt Buch über meine Zeit? Erstens wollte ich wissen, ob die chronische Erschöpfung, die mein Tun mit sich bringt, nur eingebildet ist, oder ob ich tatsächlich viel mehr als 42 Stunden arbeite – wenn ich all das nervige Zeug, das ich nicht aus Privatvergnügen mache, als Arbeit mitzählen darf. Zweitens will ich Grundlagen für Entscheidungen darüber schaffen, welche Aufgaben ich abgeben muss, um anderes dafür machen zu können – was mir wichtiger ist oder mehr Spaß macht. Drittens kann ich, wenn ich das Ergebnis meiner Zeitverbrauchsanalyse vor mir sehe, hoffentlich entscheiden, ob ich mir all die unbezahlten Dinge eigentlich leisten kann – oder ob ich davon etwas fallen lassen MUSS, um stattdessen Geld zu verdienen. Viertens sollte mir meine Untersuchung darüber Aufschluss geben, was ich mir für die Zukunft vornehmen kann. Zum Beispiel hatte ich vor, im nächsten Sommer ein Glashaus aus alten Fenstern zu bauen. Ähnliche Dinge habe ich mir in den vergangenen Jahren auch schon vorgenommen, aber Frühling und Sommer kamen und gingen, ohne dass ich auch nur geschafft hätte, den Weihnachtsbaum zu entsorgen. Wenn ich weiß, was ich mache (und wofür), kann ich hoffentlich ein realistisches Zeitbudget für die Zukunft erstellen.
Seit meiner Rückkehr aus Twin Oaks habe ich schon einige Dutzend Wochenarbeitszettel ausgefüllt. Es ist offensichtlich, dass ich die Twin-Oaks-Quota überschreite. Meine Stundenzahl inklusive Abspülen und Ehrenamt pendelt sich bei etwa 50 Stunden pro Woche ein – immerhin kein Wert, bei dem ich gleich verzweifeln müsste. Freilich werden nur wenige dieser Stunden bezahlt – mit Müh und Not bleibt mein Konto im Plus. Zu viel Kunst, zu viel Lokalpolitik (damit sind (Entscheidungs-)Prozesse in Sieben Linden gemeint, MW), zu viel Arbeit bei der Pflege meiner Mutter – aber gerade diese Sachen sind mir wichtig. Nachdem ich mich allerdings dafür entschieden habe, ein Buch zu schreiben und dafür Zeit zu reservieren, wird es wohl nichts mit dem Fensterhaus. Nur eins von beidem geht. Da spricht mein Stundenzettel eine deutliche Sprache und bewahrt mich hoffentlich vor Überforderung.
Ideal wäre, wenn auch die anderen Menschen, mit denen ich gemeinsame ökonomische Pläne habe, solche Zettel führen – und wir zusammen einen Jahres-Zeit-Etat für unsere Ideen aufstellen. Kleinkrämerisch Minuten in Stundenbruchteile umzurechnen ist zwar unsexy, wenn ich durch so eine Planung entspannter leben würde, hätte es sich gelohnt. Dass das irgendwann eine Selbstverständlichkeit sein kann, habe ich in Twin Oaks erlebt.
(Fotos: Michael Würfel)